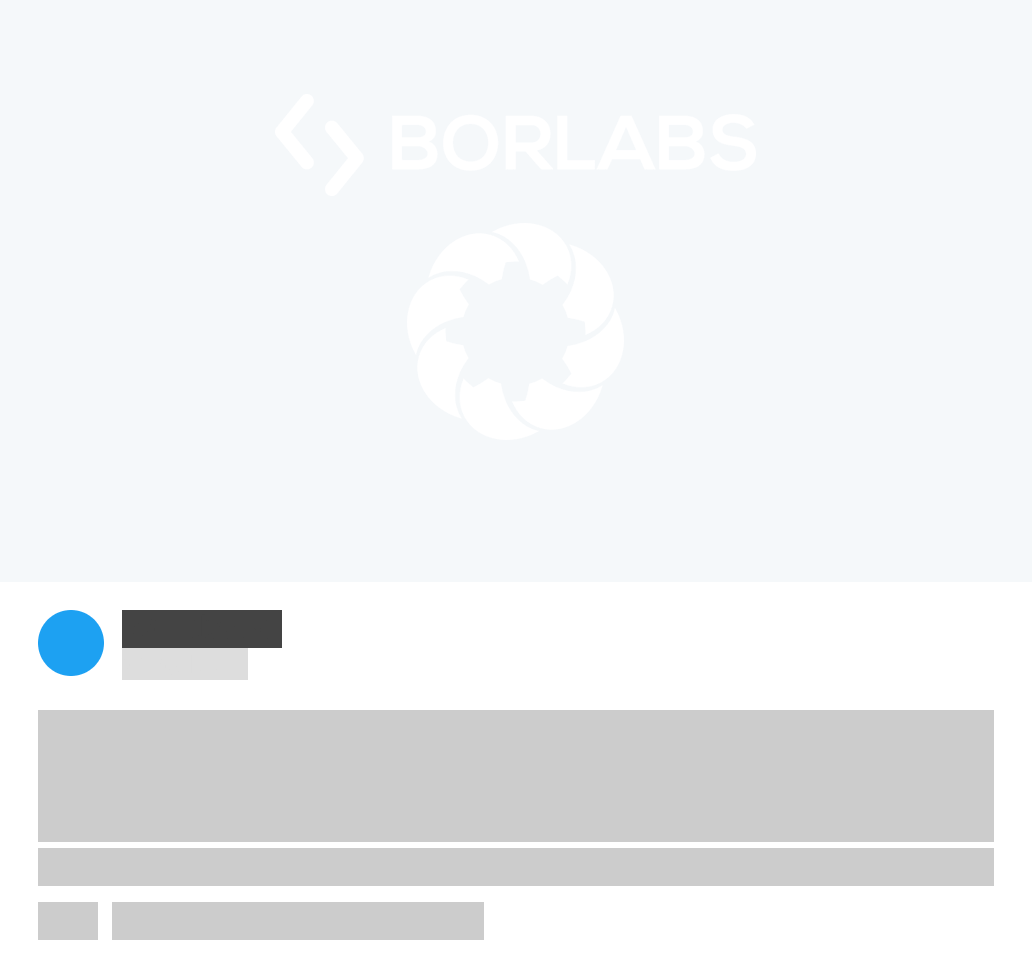Hat selbstbestimmtes Arbeiten etwas mit der individuellen Gesundheit zu tun? Bei einer meiner letzten Recherchen fiel mir auf, dass gerade junge Unternehmen in Stellenanzeigen und auf ihren Websites häufig damit werben, dass zusätzlich zum selbstorganisierten und eigenverantwortlichen Arbeiten auch Fitnessstudio-Abos, regelmäßige Yoga-Kurse und tägliche Verpflegung mit vegetarischer Küche und Bio-Lebensmitteln den MitarbeiterInnen kostenlos angeboten werden. Weniger hip organisierte und/oder etablierte Unternehmen preisen eher familienorientierte Arbeitszeiten in „offenen, modernen Bürolandschaften“ an und weisen auf ein betriebliches Gesundheitsmanagement hin.
Tolle, neue Arbeitswelt, möchte man meinen, oder? Böse Zungen (ich zähle meine eigene dazu) würden jetzt einwenden, dass es sich bei diesen sogenannten „Benefits“ um die #Verbällebadisierung von NewWork oder #NewWorkWashing handelt – zumindest, wenn es sich um rein kosmetische Maßnahmen handelt, die der Belegschaft noch mehr Leistung abverlangen sollen.
Arbeitsunfähigkeit durch psychosoziale Belastungen
Insbesondere beim Thema Gesundheit ist jedoch ein genaues Hinschauen sinnvoll: Am letzten Sonntag waren wir zu Gast beim Gesundheitstag des Burnout-Präventivteams in Stuttgart. Unter den Besuchern waren etliche, die sich sicherlich in der 2/3-Mehrheit der Unzufriedenen des jährlichen Gallup-Engagement-Index wiederfinden. Unzufriedenheit gepaart mit negativ empfundenem Stress kann sich zum Burnout entwickeln. Burnout zählt zu den psychischen Erkrankungen, die in den letzten Jahren die häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit darstellen – lt. DAK-Gesundheitsreport 2015 lagen psychische Erkrankungen an 3. Stelle der AU-Ursachen in Deutschland, im DAK-Gesundheitsreport 2018 lagen sie bereits an 2. Stelle.
Die Ausfallzeiten bei psychischen Erkrankungen liegen bei durchschnittlich ca. 32 Arbeitstagen pro Jahr und Fall. Übereinstimmend berichten verschiedene Krankenkassen (AOK, DAK, TK) über einen beachtlichen Anstieg von psychischen Erkrankungen. Ähnliches beobachtet die Deutsche Rentenversicherung: Berentungen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nehmen kontinuierlich zu, ca. 38% der neu bewilligten Berentungen (2013) lassen sich auf psychische Ursachen zurückführen.
Das Burnout-Krankheitsbild ist komplex und hat sowohl arbeits- als auch personenbezogene Faktoren. Es ist lt. DGPPN (Deutsche Gesellschaft f. Psychatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde) nicht mit einer Depression gleichzusetzen, stellt keine medizinische Diagnose dar und ist bis heute nicht als eigenständige Krankheit gelistet. Allerdings wird es als Zusatzdiagnose mit anderen Diagnosen eingrenzbar und dokumentierbar, z.B. als „Problem mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung.
Was Burnout-Prävention mit selbstbestimmter Arbeit zu tun hat
Eine repräsentative Querschnittsstudie (1. Teilstudie, Arbeits- und individuumsbezogene Determinanten für die Vulnerabilität gegenüber Burnout und Depressionen, Teilnehmende: 4.058 Berufstätige, 31-60 Jahre alt, 2018) im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) nennt – wenig überraschend – u.a. folgende Hauptergebnisse, die unmittelbar mit dem Burnout-Syndrom in Beziehung gesetzt werden können:
- Quantitative Arbeitsbelastung als Hauptrisikofaktor, gefolgt von kognitiven Belastungen und Arbeitsplatzunsicherheit
- Führungsqualität und Entscheidungsspielraum stellen schützende Faktoren dar
- allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung als schützender Faktor
Im Kontext Neue Arbeit kann dies bedeuten, dass Organisationsmodelle, in denen Führung strukturiert, aber wenig und eher moderativ statt kontrollierend ausgeübt wird, schützende Faktoren gegen psychische Erkrankungen darstellen. Selbstbestimmtes Arbeiten ganzheitlich im Sinne von mehr Partizipations- und Entscheidungsmöglichkeiten verstanden (nicht reduziert auf flexible Arbeitszeiten und -orte) würde somit die Gesundheit und damit auch die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden fördern.
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz? Fehlanzeige.
Überlegt man weiter, welche Kosten die Ausfälle durch Burnout am Arbeitsplatz verursachen, müsste es nahezu logisch sein, dass die Mehrzahl an Unternehmen längst regelmäßige Burnout-Präventiv-Programme anbietet, oder? Scheinbar nicht, denn lediglich 22% der Unternehmen haben eigene Programme zur Prävention, wie z.B. Stressmanagement oder Gesundheitsvorsorge und nur 17% bieten Programme zur Reintegration wie z.B. flexible Arbeitszeiten oder Coachings an (Statista-Umfrage, 01/2017).
Auch im internen Umgang hapert es mit dem intelligenten Umgang: Rund 44% der Kollegen und 42% der Vorgesetzten von Burnout-Betroffenen wussten von der Erkrankung, tauschten sich aber nicht dazu miteinander aus, weil der/die Betroffene den Austausch nicht aktiv anging. 18% der Vorgesetzten und 10% der Kollegen ignorierten die Erkrankung oder machten sie dem/der Betroffenen gar zum Vorwurf.
Kommunikation über psychische Erkrankungen
Unsere auf Leistung gepolte Gesellschaft definiert Erkrankungen – gleich welcher Art – als Abweichung von der Norm und damit als negativ und nicht wünschenswert. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Betroffene ihre Erkrankungen in einem Umfeld, in dem der Faktor Leistung dominiert, nicht offen ansprechen und sich gegebenenfalls sogar selbst für ihre Nichtleistungsfähigkeit schämen. Diametral entgegengesetzt läuft übrigens die Kommunikation, wenn man im privaten Bereich mit der 75-jährigen Tante Ilse spricht: die berichtet über nichts anderes als über ihre diversen Krankheiten, Operationen, Arztbesuche und kennt gleichermaßen Geburts- und Todestage ihres direkten Umfeldes. Es braucht demnach grundsätzlich eine Entstigmatisierung und Befreiung von einer Art Opferrolle, in die Betroffene hineinkategorisiert werden.
Leider ist es so, dass in der Kommunikation zu Burnout die Opferrolle noch zu oft gepflegt wird. Auch beim Gesundheitstag in Stuttgart wurde dies in einem Impulsvortrag deutlich. Der Tenor lautete „das Leben kann man nicht ändern, aber es liegt nur an Dir selbst und Du hast die Möglichkeit andere Perspektiven einzunehmen.“ Es ist sicherlich richtig an die individuelle Kraft und Stärke zu appellieren und sie wieder zu aktivieren. Allerdings ist dies nur die Hälfte der Wahrheit. Denn der*die Betroffene muss – sofern er*sie nicht aussteigen möchte – wieder zurück in eine Leistungsgesellschaft, in der viele Strukturen destruktiv sind. Aktuell angebotene Präventionsmaßnahmen, wie Yoga-Angebote oder Anti-Stress-Programme, können sicherlich helfen, Symptome zu lindern, aber ein guter Arzt wird auch an die Ursachen gehen wollen, damit sich der Erfolg langfristig einstellt.
Verhältnis- und Verhaltensprävention
Eine sinnvolle Burnout-Prävention im Unternehmen sollte daher zwei Ebenen umfassen:
- individuelle Ebene (Verhaltensprävention):
direkte Programme, die die physische und psychische Gesundheit fördern (z.B. Achtsamkeits- u. Entspannungstechniken), idealerweise partizipativ zwischen AN und AG entwickelt - Organisationsebene (Verhältnisprävention):
Minimierung von ineffizienten Arbeitsprozessen und -strukturen, Erhöhung der Partizipations- und Entscheidungsmöglichkeiten für Mitarbeitende, eine auf Dialog angelegte Kommunikations- und Fehlerkultur, Kooperations- statt Konkurrenzdenken
Das Arbeitsschutzgesetz gibt der Verhältnisprävention den Vorrang gegenüber der Verhaltensprävention (ArbSchG §4 „Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen.“)
Für HR-Bereiche im Kontext neuer Arbeit bietet ein kluges und partizipativ entwickeltes Gesundheits- und Präventionsprogramm eine gute Gelegenheit das eigene Unternehmen strategisch sinnvoll mitzugestalten.
Frauen und Burnout
Der o.g. Bericht des BauA kommt zwar zum Ergebnis, dass es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede für Burnout und Arbeitsfähigkeit gibt, dennoch sind laut DAK-Gesundheitsreport mehr Frauen als Männer von Burnout betroffen. Dies legt nahe, dass die Ursachen eher im System zu suchen sind, z.B. weil in pflegenden Berufen, eine der Risikoberufsgruppen, mehr Frauen als Männer arbeiten. Oder weil Frauen aufgrund soziokultureller Prägung unterstützt von vielfältig wirkenden Stereotypen eher als Männer dazu neigen, sich „aufzuopfern“ und eigene Bedürfnisse nicht so wichtig zu nehmen.
Im Kontext dieser Stereotype und im Diskurs zum „Recht auf Homeoffice“, sei hier die gerade veröffentlichte Studie der Hans-Böckler-Stiftung zum Arbeiten im Homeoffice und selbstbestimmter Arbeitszeit genannt:
„Haben Mütter selbstbestimmte Arbeitszeiten, widmen sie der Erwerbsarbeit wöchentlich eine knappe Stunde mehr als Mütter mit festen Arbeitsstunden. In die Zeit mit Kindern fließen bei ihnen anderthalb Stunden zusätzlich.“
Im Homeoffice kommen Mütter sogar auf 3 Stunden mehr Betreuungszeit für Kinder. Väter hingegen leisten lt. Böckler-Studie im Homeoffice wöchentlich 2 Überstunden, verbringen aber nicht mehr Zeit mit ihren Kindern.
Wollen wir also erreichen, dass Menschen am Arbeitsplatz – egal ob der im Unternehmen ist oder zu Hause – gesund und produktiv sind, sollten Gesundheitsförderung, Arbeitszeit- und ortgestaltung sowie Arbeits- und Entscheidungsstrukturen mit ihren Wechselwirkungen zusammengedacht werden, damit sich daraus intelligentes und gesundes Arbeiten entwickeln kann. My 2 cents zum #Frauentag am Freitag.
Bis neulich,
Daniela
Quellen:
Statista-Dossier, Depression und Burn-Out-Syndrom
https://www.dak.de/dak/bundes-themen/gesundheitsreport-2018-1970320.html
BauA-Studie „Arbeits- u. individuumsbezogene Determinanten für die Vulnerabilität gegenüber Burnout und Depression
https://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/14_118715.htm
Bildquelle:
pixabay, CC-0 Lizenz, gemeinfrei