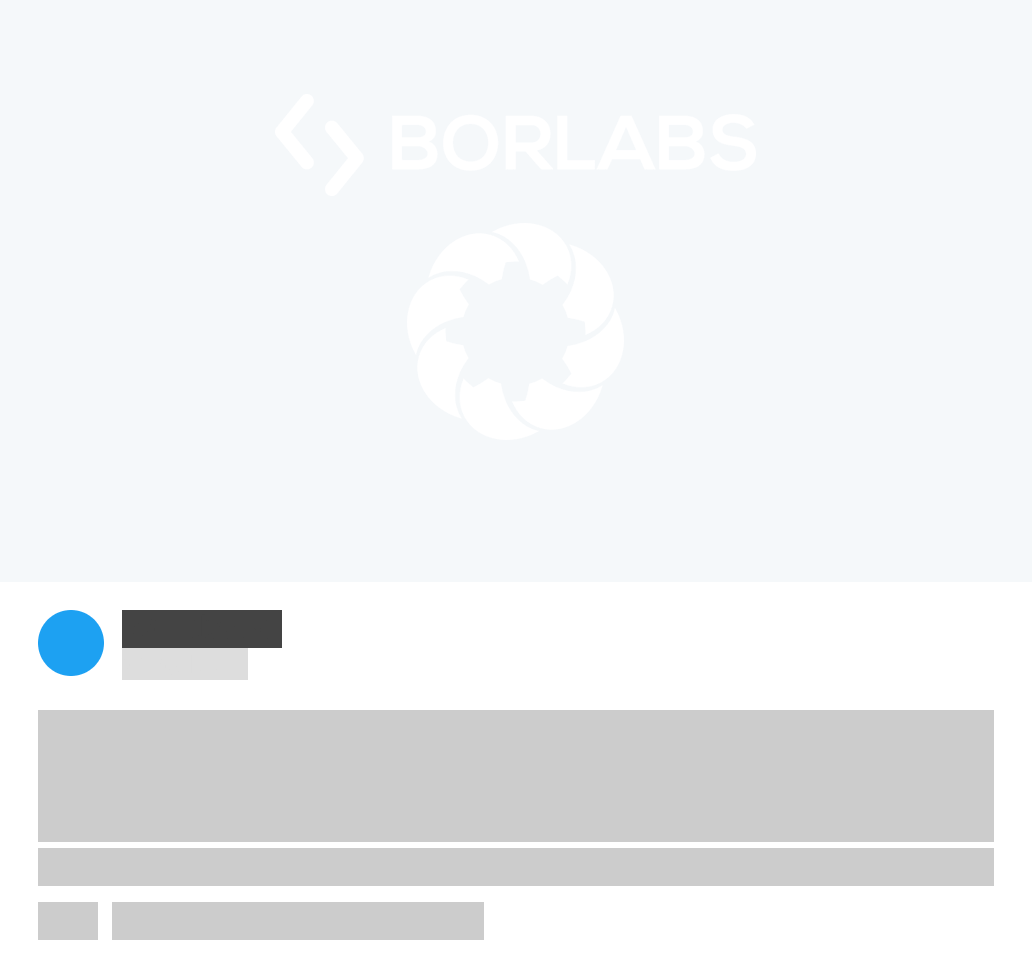Der Leitsatz des Bauhaus-Architekten Ludwig Mies van der Rohe „form follows function“ – die Form folgt der Funktion – führte zu wunderbar reduktiven Elementen und Bauweisen, die keinen Raum für unnütze Schnörkeleien verschenkten, die die Funktionalität stören konnten. Als Künstlerin frage ich mich manchmal – war das richtig? Hat nicht auch die Natur Formen vorgesehen, die so üppig sind, dass sie für das menschliche Denken als überflüssig scheinen? Sind Schnörkeleien, Ecken, Grate, Kanten überflüssig? Ist Üppigkeit gleich überflüssig? Was heißt über-flüssig überhaupt? Nach flüssig kommt gasförmig – oder fest, je nachdem von welcher Seite man schaut.
Betrachten wir unter diesen Formaspekten unser Arbeits- und Lebens-Verhältnis erscheint uns da schon Vieles, was überflüssig im Sinne von unnötig ist und daher einer Überarbeitung bedürfte, damit es gut funktioniert: chaotisches Zeitmanagement, ins Leere führende Kommunikation, Arbeitsprozesse, die nicht aufeinander abgestimmt sind, Entscheidungen, die aufgeschoben werden.
Diese Situationen scheinen über-flüssig mit Tendenz zum festen Zustand hin zu sein, weil sie sich partout nicht auflösen wollen. Auf der anderen Seite der Aggregatzustände sind wir es selbst, die wir uns über-flüssig machen und unter zunehmendem Druck von allen Seiten in einen gasförmigen, fast transzendenten Zustand transformieren. Ratgeber und Medien beschwören die Work-Life-Balance, den gesunden Ausgleich zwischen Freizeit und Arbeit. Die Bereiche Arbeit und Leben werden hier strikt getrennt, obwohl sie nicht zu trennen sind. Sie wissen das längst. Wir sind schon zu Schulzeiten darauf vorbereitet worden, dass danach das Arbeitsleben, der „Ernst des Lebens“ kommt. Und dass, wer nicht arbeitet, faul ist und es zu nichts bringen wird.
Was dieses „Nichts“ ist, hat uns allerdings damals niemand verraten. Auf jeden Fall ist Arbeit das halbe Leben, das war klar – die andere Hälfte ist Freizeit. Und weil wir das schon so früh verinnerlicht haben und unsere ganze Gesellschaft auf tätiges Arbeitsleben eingestellt ist, fühlen wir uns auch so schlecht, wenn wir ohne Arbeit – arbeitslos – sind. Nicht ohne Grund liegt laut einer Studie des Forschungsinstituts IGES der Stresspegel bei Arbeitslosen höher als bei Erwerbstätigen.
Lernen wir Menschen kennen, lautet spätestens die dritte Frage „Und was machst Du so beruflich?“ Die Arbeit ist unser Identifikationsfaktor Nr. 1. Üblicherweise sind wir „always on“, lesen nach Feierabend oder am Wochenende berufliche E-Mails, nehmen Arbeit mit nach Hause und arbeiten sogar im Urlaub für die Firma, in der wir tätig sind.
Ungeachtet der Tatsache, dass es eine gute Balance zwischen Arbeits- und Privatleben geben muss, können wir die beiden Bereiche nicht mehr trennen. Es gibt keine klaren Linien in diesem Spiel, es ist voller Schnörkel, Wulste, Ecken, Vor- oder Rücksprünge. Wäre es da nicht sinnvoll, die Arbeit so zu gestalten, dass sie zu uns und unserem Leben passt? Damit wir Luft schaffen für das, was wichtig ist? Nämlich unser Wohlbefinden? Unsere mentale und körperliche Verfassung? Dazu müssten wir jedoch reduzieren, sinnvolle Linien und fließende Übergänge schaffen, zwischen denen wir agieren können. Wir müssten unsere eigene Form definieren – wer bin ich und warum handle und denke ich so, wie ich es gerade tue?
Wenn wir diese Form gefunden haben – eine plastische Form – ist Bewegung in viele Richtungen möglich; Bewegung, die zwischen fest, flüssig und gasförmig lustvoll wandeln kann, je nachdem welcher Zustand gerade notwendig ist – immer gesteuert vom freien Willen.
Diese Bewegung hat immer eine Funktion, diese Bewegung ist das, was wir mit voller Leidenschaft machen möchten und nicht das, wohin wir geschoben oder gedrückt werden. Ein sinnerfülltes und befriedigendes Arbeits- und Privatleben ist immer Bauhaus – nur umgekehrt: Die Funktion darf üppig ausfallen, aber sie folgt unserer Form.