New Work – mittlerweile habe ich eine ausgeprägte Hassliebe zu diesem Begriff. Am liebsten würde ich mich von ihm verabschieden. Denn das Verständnis darüber, was dieses New Work ist, treibt immer seltsamere Blüten. Die „Verbällebadisierung“ ist dabei eine der harmloseren Varianten. Die ursprüngliche Bedeutung, die ihm von Bergmann gegeben wurde, lassen mich aber doch immer wieder darauf zurückkommen – ich will ihn dann doch nicht kampflos überlassen. Einen aus mehreren eigenen Erfahrungen und Berichten konstruierten „Missbrauchsfall“, wie er sicher kein Einzelfall wäre, beschreibe ich im folgenden Märchen. Der Versuch „New Work“ mit Selbstorganisation und Eigenverantwortung einzuführen, weil es an Führungskompetenz mangelte, Entscheidungen hin und her geschoben wurden und es den Führungskräften an sozialen Fähigkeiten fehlte. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, daher sieht das anfänglich nach einer treffenden Idee aus. Gleichwohl stellte sich diese Mischung als hoch toxisch heraus. Eine kurze Geschichte darüber, was passiert, wenn man nicht verstanden hat, was man tut.
Es war einmal ein Unternehmen, wie es sie so viele in Deutschland gibt. Bescheiden gegründet, anfangs mit vier Leuten, über die Jahre zu einem kleinen mittelständischen Unternehmen mit rund 25 Kolleg*innen gewachsen. Die Organisation war durch Hochs und Tiefs gegangen, aber beständig größer geworden. In verschiedenen Wachstumsstufen gab es immer wieder unterschiedliche Schmerzen, die wurden bisher mehr oder weniger durchgestanden. Was sechs Menschen über den kleinen Dienstweg abhandelten, führte bei einem bunt zusammengewürfelten Haufen aus über zehn Bediensteten schon zu Problemen. Die ausschließlich von der Geschäftsführung, äh Herrschaft, eingestellten Menschen hatten unterschiedliche Ansichten, über die Ziele und die Zusammenarbeit in der Organisation – viele Einstellungen vollzogen sich nach dem Motto, wir nehmen, was wir bekommen – denn es herrschte Fachkräftemangel. Während die Gründer ihr Produktbaby romantisierten und heroisierten, verstanden die Neuen nicht einmal genau, was das Produkt ist und was die Menschen davon haben. Einig war man sich darin, nicht zu fragen, was der Kunde braucht. Es ging vor allem darum, zu verkaufen, wie war erst einmal egal.
Erstmal sind immer die anderen schuld
Da dieses Vorgehen in der Praxis nicht klappte, schoben sich die verschiedenen Bereiche des Unternehmens die Schuld daran gegenseitig zu: Das Marketing erzeugte keine überzeugende Werbung, der Vertrieb war nicht in der Lage zu verkaufen, das Produkt war nicht gut genug, in der Produktion passierten zu viele Fehler, … Das Unternehmen taumelte mächtig, weil eine zielführende interne Kommunikation nicht stattfand. Keiner der Herrschaften hatte gelernt zu führen oder wie in so einer Situation vernünftig gehandelt werden könnte. In ihrer Hilflosigkeit fingen sie an, ihren Untertanen zu drohen und es wurde öfter laut. Zu was das führt, drückt ein Tweet, der mir kürzlich auffiel, perfekt aus:
Seine Mitarbeitenden anzuschreien ist die ehrlichste Form der Inkompetenz.
Oft ist das auch der Anfang vom Ende einer Führungskraft. Denn solche Vorfälle lagern sich im kollektiven Gedächtnis eines Unternehmens ab und werden selbst Jahre später noch von Kopf zu Kopf gereicht.
— Christian Müller (@cmueller80) 2. April 2019
Die Untertanen waren eingeschüchtert. Das Unternehmen taummelte weiter. Nahezu die Hälfte der Dienerschaft wurde von einem auf den anderen Tag in einer Hauruck-Aktion gefeuert. Ein größerer Auftrag rettete die Firma und sie rappelte sich auf. Neue Untertanen wurden eingestellt, viele davon gingen recht bald wieder.
Abgekoppelt, nicht sinngekoppelt
Den Kern der Verbliebenen bildeten informelle kleine Zünfte, die ihre jeweiligen Bereiche am Laufen hielten. Eine wirkliche Kommunikation zwischen den Bereichen fand weiterhin nicht statt. Der Herrschaftsbereich war vom Alltagsgeschehen der Untertanen nahezu abgekoppelt. Die Herrschaft kümmerte sich rührend um ihr kleines Baby – das Produkt. Sie feilte daran, tüftelte und entwickelte weiter. Den Rest der Dienstbotenschaft ließen sie machen. So werkelte das Unternehmen einige Jahre vor sich hin. Die Untertanen kamen morgens zur Arbeit, begaben sich in ihre kleinen Zünfte, erledigten mehr oder weniger motiviert ihre Arbeit und gingen, meist pünktlich nach 8 Stunden, wieder – auch eine Form der Selbstorganisation. Aber keine zufriedenstellende, denn hinter den Kulissen wurde viel gemurrt. Die Fluktuation auf der Untertanenebene war hoch. Die Geschäfte liefen zwar ok, aber nachhaltig stabil wurde die Firma nicht.
Die Herrschaft aber wollte vorankommen. Wollte, dass das Unternehmen wächst und robuster wird. Daher setzte sie als Ziel, dass das Produkt so bekannt wird, dass der Name des Produkts in Zukunft synonym mit der Produktgattung verwendet wird – „wie Tempo für Taschentücher“. Ein hehres Ziel, doch von den meisten Untertanen wurde dies nicht ernst genommen. Wie wollte das Unternehmen dies schaffen? Dazu gab es keine Ideen, keine Pläne, keine Kommunikation. Das sollte schon jede Person selbst herausfinden – so proklamierte es die Herrschaft. Sie probierte es mit finanziellen Anreizen, mit Druck, mit agilen Methoden – funktionierte alles nicht. Sie schaffte es nicht, ihre Mitarbeiter*innen zu erreichen, ihnen zu vermitteln, was sie eigentlich wollte. Auf die Idee, genau diese Menschen mit einzubeziehen, kam erst einmal niemand.
Was nun?
Die Selbsterkenntnis, dass sie in keiner Weise Führungspersönlichkeiten sind, dämmerte der Herrschaft dann doch irgendwann. Sie suchte nach Alternativen. Versuchte es mit einem „Amtsverweser“, der die Führung des Volkes übernehmen sollte. Merkte aber, dass sie die eigene Macht sehr liebgewonnen hatten und sie daher nicht teilen wollten. Statt einen gemeinsamen Weg und Ziele zu definieren, wurde schnell gegeneinander gearbeitet – Herrschaft gegen Verweser. Dem Verweser fehlte komplett die Rückendeckung der Herrschaft. Sobald er einen Millimeter von den ausgetretenen Pfaden und der Meinung der Herrschaft abwich, gab es öffentlich und hinter seinem Rücken Gegenwind, so dass es bald zur Eskalation kam. Der „Amtsverweser“ musste wieder gehen und war froh darüber.
Was also tun, wenn ich nicht führen kann und mich mit Entscheidungen schwertue? Macht nicht abgeben will, aber mein Unternehmen voranbringen möchte? Da ist guter Rat teuer. Nun ja, irgendwann kam die Herrschaft auf dieses hippe, neumodische „New Work“ und das selbstorganisierte und eigenverantwortliche Arbeiten. „Eigenverantwortung“, dieses Wort musste die Adligen wohl angetriggert haben. Wenn die Untertan*innen für sich selbst verantwortlich sind, müssen wir das nicht mehr sein. Also machen wir das doch einfach mal, funktioniert bei anderen scheinbar auch. Von heute auf morgen hieß es: Ab sofort arbeiten wir selbstorganisiert und eigenverantwortlich. Wieso, weshalb, warum? Begründung Fehlanzeige – darauf gab es keine Antwort. Die Fragezeichen, die um die Köpfe der Untertan*innen schwirrten, waren nahezu greifbar. Zu fragen traute sich niemand so richtig, teilweise wegen der überraschenden Bekanntmachung, teils weil sie das Ganze nicht greifen konnten und nicht zuletzt, weil das frühere Verhalten der Herrschaft natürlich dadurch nicht einfach weggewischt war: Drohen, Druck machen und feuern, wenn jemand nicht passt. Mit Verlaub, ich erinnere noch einmal an den oben bereits zitierten Tweet:
„Seine Mitarbeitenden anzuschreien ist die ehrlichste Form der Inkompetenz. Oft ist das auch der Anfang vom Ende einer Führungskraft. Denn solche Vorfälle lagern sich im kollektiven Gedächtnis eines Unternehmens ab und werden selbst Jahre später noch von Kopf zu Kopf gereicht.“
Pseudo-New-Work
Was passierte nun? Erst einmal nicht viel. Denn es ging ja so weiter wie vorher. Jede Dienstbotenabteilung machte ihren Kram wie bisher. Bis auf einige herrschaftlich vorgegebene Plattitüden – „Wir sind, die Besten, die Schönsten, die Innovativsten und unser Produkt ist das geilste und alle anderen können nichts“ – gab es kein gemeinsames Verständnis, für das, was man zusammen jeden Tag macht, wohin die Organisation will, worin eigentlich der Sinn liegt.
Also wurde weiterhin von 9 – 17 Uhr gearbeitet. Manche jetzt manchmal aus dem heimeligen Zuhause und mal ging jemand ein bisschen früher oder später, ohne zu fragen. Die Herrschaft blieb weiter an ihrem Produkt kleben. Solange, bis wieder etwas nicht in deren Kram passte. Lief irgendetwas nicht so, wie sie es wollte, gab es weiterhin Stress mit Androhung von Sanktionen.
Mit der Zeit fühlte sich die Herrschaft bemüßigt – vielleicht aus Langeweile oder Mangel an Spaß -, Formate einzuführen, welche den gemeinschaftlichen Austausch befördern sollten. Diese gingen, ob der oben erläuterten Voraussetzungen, selten über Teambuilding-Maßnahmen und Besprechungen über die Verbesserung der Produkte hinaus. Es traute sich kaum ein Untertan, an die Kernprobleme der gesamten Gruppe ranzugehen. Nur ganz Mutige kratzten ab und zu an der Oberfläche. Dieser Mut blieb aber erfolg- und wirkungslos.
Dem interessierten öffentlichen Publikum wurden die Maßnahmen als „New Work“ verkauft. Die Wirtschaft boomte und es wurden dringend neue Untertan*innen gebraucht, um die Aufträge abarbeiten zu können. Doch die Untertanendecke wurde nicht dicker, sondern dünner. Bald krachte es wieder. Zuerst wurden Untertanen ohne ersichtlichen Grund von der Herrschaft verbannt. Natürlich ohne Erklärungen dazu und nur mit wenigen inhaltslosen Ausflüchte, denn eine Herrschaft braucht sich nicht zu erklären. Bald darauf gab es Ärger, weil Untertanen dieses „New Work“ ernst nahmen und eigenverantwortliche Entscheidungen trafen. Damit war die Herrschaft gar nicht einverstanden – wieder kam es zu Trennungen…
Seit Jahr und Tag und auf den heutigen Tag ist die Uhr wieder zurückgedreht und es wird weiter vor sich hin gewerkelt. Es ging dieser Herrschaft nie darum, wirklich etwas grundlegend zu ändern. Sie wollte einfach nur die Verantwortung abgeben, ohne die eigene Macht aufzugeben. Die Untertan*innen sollten „unternehmerischer“ denken, ohne ihre Lohn- und Disziplinarabhängigkeit aufzugeben. Partizipation war maximal auf der operativen Ebene möglich und nur soweit erwünscht, wie es der Herrschaft in den Kram passte. Andere Meinungen, Diversität in Diskursen, gemeinsame Sinnentfaltung, Streit-, Dialog-, oder Fehlerkultur, Selbstbestimmung und Partizipation – alles Fehlanzeige. Doch ohne diese Dinge funktioniert dieses „New Work“ eben nicht. Das ist lediglich schönfärberischer Tand, oder neudeutsch: Employer-Washing.
Die Moral von der Geschicht‘
Nun höret die Moral von der Geschicht: Wenn ich nur meine eigene Meinung durchsetzen will, wenn ich keinen Millimeter von meiner Philosophie abweichen will, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, mich damit auseinander zu setzen, was meine Mitarbeiter*innen möchten, welche Probleme sie haben und was sie brauchen, um vernünftig zu arbeiten. Wenn ich keine wenigstens halbwegs offene Kommunikationskultur habe, dann geht der Schuss nach hinten los und dieses „New Work“ oder selbstbestimmte Arbeiten fliegt mir um die Ohren. Denn auf der anderen Seite steht eine Erwartung, die erfüllt werden möchte. Wird sie dies nicht und wenn es nur darum geht, dass die Menschen in der Organisation einen kleinen Teil Ihrer vorgegebenen Arbeit selbst organisieren dürfen und ansonsten weiterhin wie Schafe behandelt werden, kehrt sich die Erwartung ins Negative um. Das Negative zeigt sich in Dienst nach Vorschrift oder innerlicher (oder äußerlicher) Kündigung. Kann man machen, aber das hat mit Selbstbestimmung und dem was die Menschen wirklich, wirklich wollen nichts zu tun. Und schon gar nichts mit verantwortungsvoller Unternehmensführung.
Gehabt Euch wohl!
Stefan
Bildquelle: Pixabay, CC-0 Lizenz gemeinfrei, bearbeitet

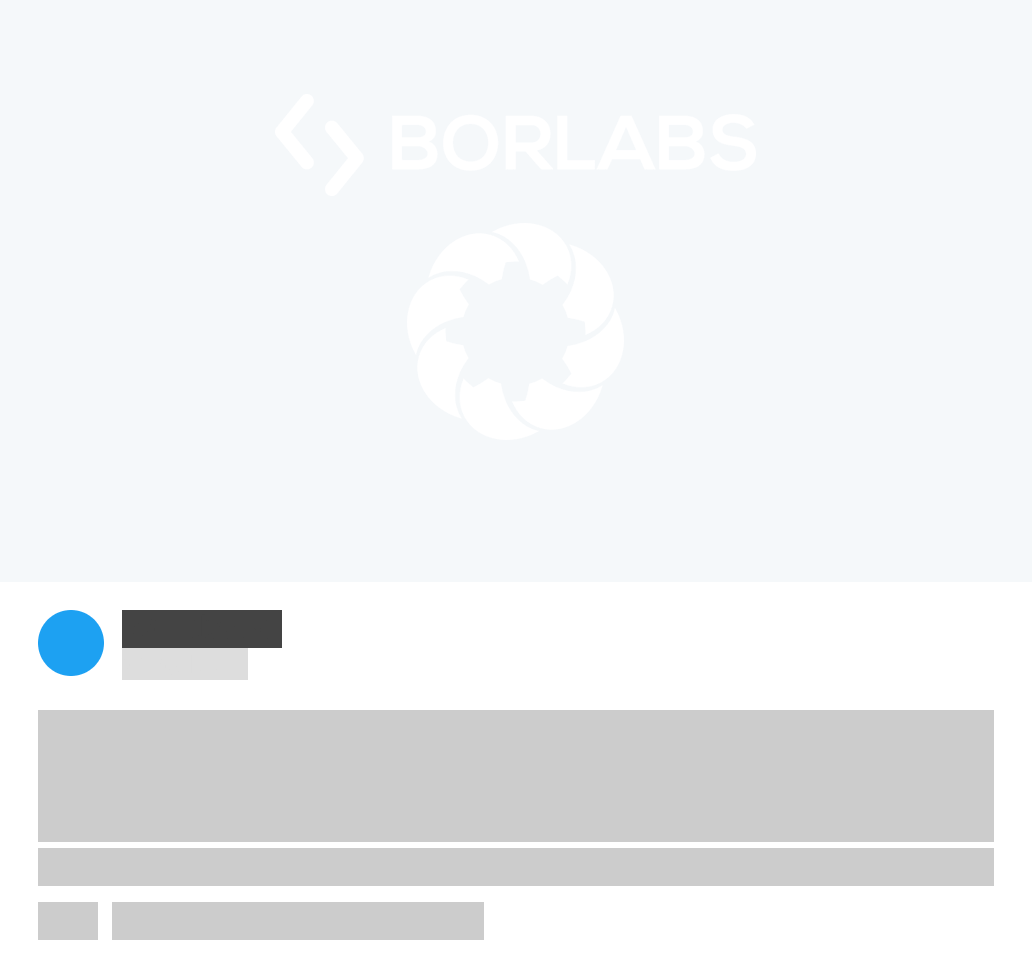
Trackbacks/Pingbacks