„Ihr macht doch sicher auch situative Führung, oder?“, fragte die Anruferin am anderen Ende der Leitung. Es ging, Achtung Überraschung, um ein Führungskräfteentwicklungstraining, in welchem die Damen und Herren lernen sollen, wie man im New-Work-Zeitalter gut führt. Man mag sich am Begriff „Führungskräfteentwicklung“ zu Recht stoßen, aber sei’s drum, er wird vielerorts noch – unreflektiert – verwendet.
Situative Führung – kennt die überhaupt jemand?
So, situative Führung soll es also sein. Wie macht man das denn? Und geht das überhaupt? Bisher habe ich noch keine einzige Führungskraft kennengelernt, die gesagt hat „Ich führe mein Team situativ“ oder „Mein Führungsstil ist situativ“. Eher ist es so, dass man sich im Alltag keine Gedanken darüber macht, welchen theoretisch beschreibbaren Führungsstil man selbst hat oder welchem man sich als Mitarbeiter*in unterordnet. Das „unterordnet“ verwende ich bewusst, denn ganz gleich wie flach die Hierarchien im Unternehmen sind: als Angestellte bin ich alleine schon begrifflich in einem Abhängigkeitsverhältnis, der gesellschaftliche Rahmen definiert mich als „abhängig Beschäftigte“, sobald ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Komischerweise gibt es umgekehrt den Begriff „abhängiges Unternehmen“ nicht.
Die Situation ist vorbei – Wo war die situative Führung?
Situative Führung im Alltag konkret zu erkennen ist eine relativ komplexe Angelegenheit, weil sie nicht gut in Echtzeit zu beobachten ist und sie mit diversen Unsicherheitsfaktoren umgeben ist, dazu später mehr. Wie der Begriff schon sagt, geht es um eine fallweise, durch eine Situation bedingte Angelegenheit, die im nächsten Moment auch schon wieder überholt sein könnte. Reflektiert man im Nachhinein über die jeweilige Situation, gelingt es besser, situative Führungsaspekte zu entdecken. Allerdings ist die Situation dann schon vorüber und die Reflexion ist auf das Erinnerungsvermögen angewiesen. Im Training kann man mit intelligenten Simulationen Ähnliches erreichen, wenngleich es trotzdem immer eine Art Laborsituation ist.
Führungsmodelle von klugen Menschen
Kluge Menschen machen sich gerne theoretische Gedanken und formen daraus ein abstraktes Modell. So ist es auch bei der situativen Führung und die bekannteste Theorie stellten bereits 1977 die Herren Paul Hersey, Verhaltensforscher, und Ken Blanchard, Unternehmer, auf. Im 21. Jahrhundert nimmt frau es nicht mehr ungefragt hin, dass zwei weiße Männer etwas Bahnbrechendes geschaffen haben sollen, daher sei eine gewisse Skepsis meinerseits hier schon verraten, aber in den 1970er Jahren sah man das wohl noch anders und so erklärt sich u.a. auch, dass die Theorie Verbreitung fand.
Das Modell sieht die grundsätzliche Unterscheidung des Führungsverhaltens in Aufgabenorientierung und Personenorientierung vor:
- Aufgabenorientierung: klare Ansagen, konkrete Ziele, feste Erwartungen. Auf dieser Ebene konzentriert die Führungsperson ihr Verhalten auf das „was“ und „wie“ zur Erreichung von Aufgaben und Projekten.
- Beziehungsorientierung: bilaterale Beziehung, soziale Komponenten, Feedback, Lob und Zuhören. Dieses Verhalten erkennt den/die Mitarbeiter*in als lebendige Person mit Stärken und Schwächen in Abgrenzung zur Funktionalität einer Maschine.
Soweit so gut und richtig und mit der Unternehmerbrille auch logisch nachzuvollziehen. Denn wer jemals eine Gruppe von Entwickler*innen „führen“ musste, weiß u.U., dass genau dieser Mix angebracht ist. Achtung Nähkästchengeplauder: Es ist super, wenn ein maximal hoher Grad an Partizipation täglich gelebt wird. Aber es gibt mitunter Mitarbeiter, in diesem Beispiel sind es Software-Entwickler*innen, die schlichtweg nicht ökonomisch denken und handeln wollen, weil sie lieber 90% ihrer Arbeitszeit ungestört von äußeren Einflüssen mit Programmieren verbringen. Das ist total in Ordnung und vermutlich auch gut für die Software, aber an dieser Stelle führen eher klare Ansagen statt demokratischer Mitbestimmung zum – idealerweise trotzdem gemeinsam vereinbarten – Ziel.
Reife Mitarbeiter?!
Womit wir beim weiteren Teil des Modells nach Hersey und Blanchard wären: der Einordnung nach Reifegraden der Mitarbeiter*innen. Jeder/m New Worker*in rollen sich vermutlich beim Lesen des Begriffs „Reifegrad“ in Bezug auf Mitarbeiter*innen die Fußnägel spiralartig auf oder er verursacht mindestens einen veritablen Schluckauf. Versuchen wir den Begriff für den Moment auszuhalten und schauen, was Hersey und Blanchard sich dabei gedacht haben:
- Sachliche Reife, d.h. die rein fachliche Kompetenz, bestimmte Aufgaben lösen zu können; fachlich „reife“ Mitarbeiter sind an der eigenen Kompetenzerweiterung interessiert
- Psychologische Reife, d.h. die Motivation, der Antrieb der zur Lösung einer Aufgabe führen kann; „reife“ Mitarbeiter sind stärker motiviert und engagiert Ziele zu erreichen als „unreifere“ Mitarbeiter
Die „situative“ Entscheidung bzw. Führung in diesem Modell liegt also in der Entscheidung des/der Führenden, wann sie welches Verhalten anwendet.
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass das Modell in verschiedenen wissenschaftlichen Studien niemals als valide beurteilt werden konnte. Weder hielt es einer Prüfung stand im Sinne von „Wenn ich diesen Führungsstil anwende, ist meine Führung erfolgreich“ noch konnte die Reifegradeinteilung empirisch belegt werden. Weiterhin gibt es Unzulänglichkeiten in der Beschreibung der einzelnen Begriffe, weshalb sie ebenfalls nicht empirisch untersucht werden konnten.
Der blinde Fleck im Modell situative Führung
Warum genau ist dieses Modell nicht hilfreich, um als „Führungsstil“ zu gelten? Der Führungsstil bzw. die Führungskompetenz einer Führungsperson ist erstens untrennbar mit der Persönlichkeit, Haltung, Erfahrungswissen, Einstellungen, Annahmen, etc. verbunden. Zweitens hängt der Erfolg oder Misserfolg eines Führungsverhaltens von der Beziehung zu den „Geführten“ ab (siehe Kontingenztheorie). Beides wird im Modell von Blanchard/Hersey nicht thematisiert. D.h. das Modell startet bereits mit einem blinden Fleck und geht davon aus, dass die Führungskraft ein völlig neutrales und vielleicht leeres Objekt ist, das von einem Nullpunkt aus handelt.
Ich ergänze noch einen dritten Punkt: räumliche und zeitliche Situation zum Zeitpunkt des Verhaltens sowie mögliche Beteiligte in der Situation. Es macht einen Unterschied, ob ich als Führungskraft eine/n Mitarbeiter*in in einer lockeren und nach außen offenen Sitzgruppe anspreche oder ob er/sie mir im geschlossenen Büro gegenübersitzt mit einem Schreibtisch als Distanzobjekt.
Ergänzend macht es einen Unterschied, wenn ich mehrere Mitarbeiter*innen anspreche: In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Kenne ich diese Beziehungsgeflechte oder kann ich sie einschätzen? Sind mir die Auswirkungen der Beziehungen bewusst? Kenne ich die Erwartungen der Mitarbeiter*innen an mich oder nehme ich nur an, dass ich sie kenne? Wann spreche ich die Mitarbeiter*innen an? Morgens, mittags, abends? Kenne ich die persönliche Situation der Mitarbeitenden, die deren Verhalten und Aufnahmefähigkeit in jeder Stunde des Tages beeinflussen kann? Alleine diese wenigen Fragen machen relativ einfach verständlich – denke ich zumindest, mit wieviel realen Unsicherheiten ein theoretisches Führungsmodell belegt ist und das ganz ohne wissenschaftliche Aufarbeitung.
Und, last but not least, es ist ein alter Hut, aber er sei hier trotzdem erwähnt: Welche Fehlerkultur findet sich im Unternehmen, welche Möglichkeiten der Besprechbarkeit, wieviel Prozess- und Kommunikationstransparenz?
Warum grundsätzlich ein situativer Führungsstil trotzdem gut ist
In neuen Arbeitswelten ist es notwendig situativ zu entscheiden, daher brauchen Entscheider logischerweise auch die Kompetenz auch situativ entscheiden zu können. Die Kompetenz liegt allerdings nicht in der Anwendung von Führungsstilmodellen, denn alle Modelle eint eine Grundannahme: sie suggerieren die pauschale Einflusskraft einer Führungsperson, Menschen aktiv durch ein bestimmtes Handeln in eine bestimmte Richtung bewegen zu können. Es ist ein bisschen wie beim Yoga: ja, jede/r kann theoretisch alle Asanas ausführen. Jedoch ist jede/r an ihre/seine individuelle Anatomie gebunden und sollte sinnvollerweise nur soweit gehen, wie der eigene Körper es zulässt.
„A Leader ist someone who knows how to follow.“
Diesen Satz gebe ich allen mit auf den Weg, die situativ führen möchten. Das „know“ im Satz meint, dass eine tiefe und grundlegende Erfahrung vorhanden sein muss. Reine Empathie greift hier mitunter fast zu kurz. Ein gestandener und wirklich guter Architekt erzählte mir vor vielen Jahren, dass es zu seiner Zeit noch Pflicht war, vor dem Architekturstudium eine Maurerausbildung zu absolvieren. Die körperliche Erfahrung, ein Bauwerk von Grund auf zu erschaffen, die Erfahrung welchen Regeln das Zusammenspiel von Materialien folgt, der Einfluss von Wetter und Temperatur und die Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke auf der Baustelle, sei für ihn die Basis gewesen, später Projekte umsichtig zu leiten und erfolgreich umzusetzen. In jeder Führungssituation ist ein Moment der Beobachtung und Wahrnehmung vorgeschaltet – ein Moment der Selbstbeobachtung und der Situationswahrnehmung. Aus diesem Moment heraus entsteht ein authentisches Handeln, das eine ehrliche Wirkung und Resonanz erzielen kann; Wermutstropfen für die Nicht-Baustelle: allerdings nur, wenn vorher die oben angesprochenen Rahmenbedingungen der Unternehmenskultur erfüllt wurden. Ja, sorry, situatives Führen ist halt Knochenarbeit und findet in der Masterclass statt. Wer sich lieber verbiegt um zu führen, der/dem sei gesagt: Kann man so machen, aber dann bleibt man eben Businesskasper.
Bis neulich,
Daniela
Bildquelle: fotolia-Lizenz 63618895, bearbeitet
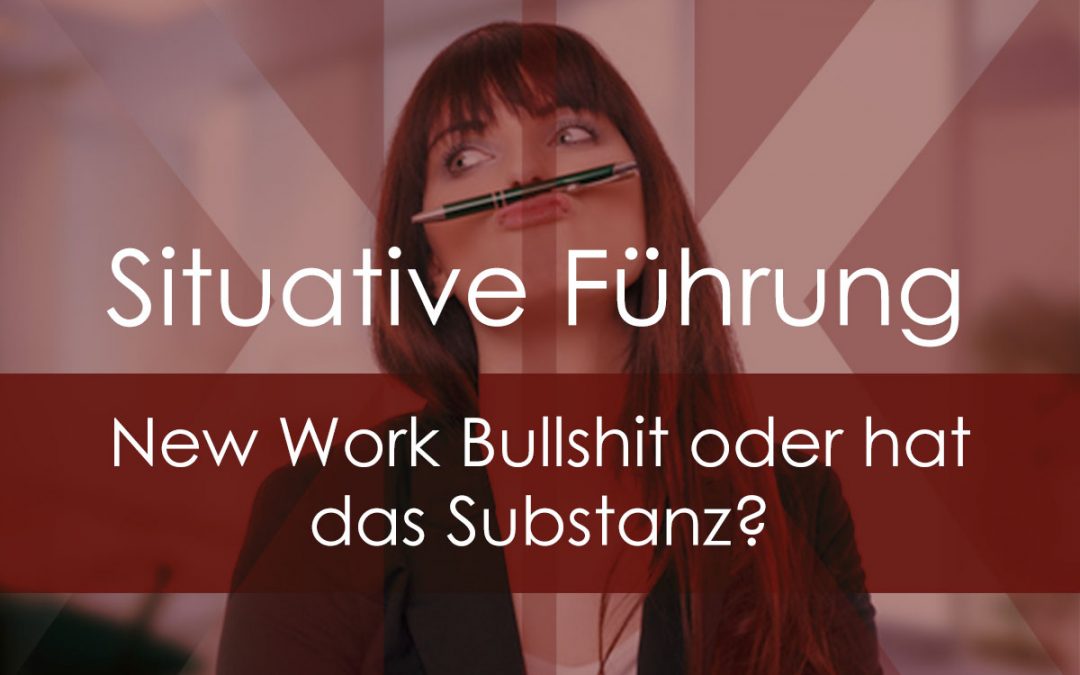
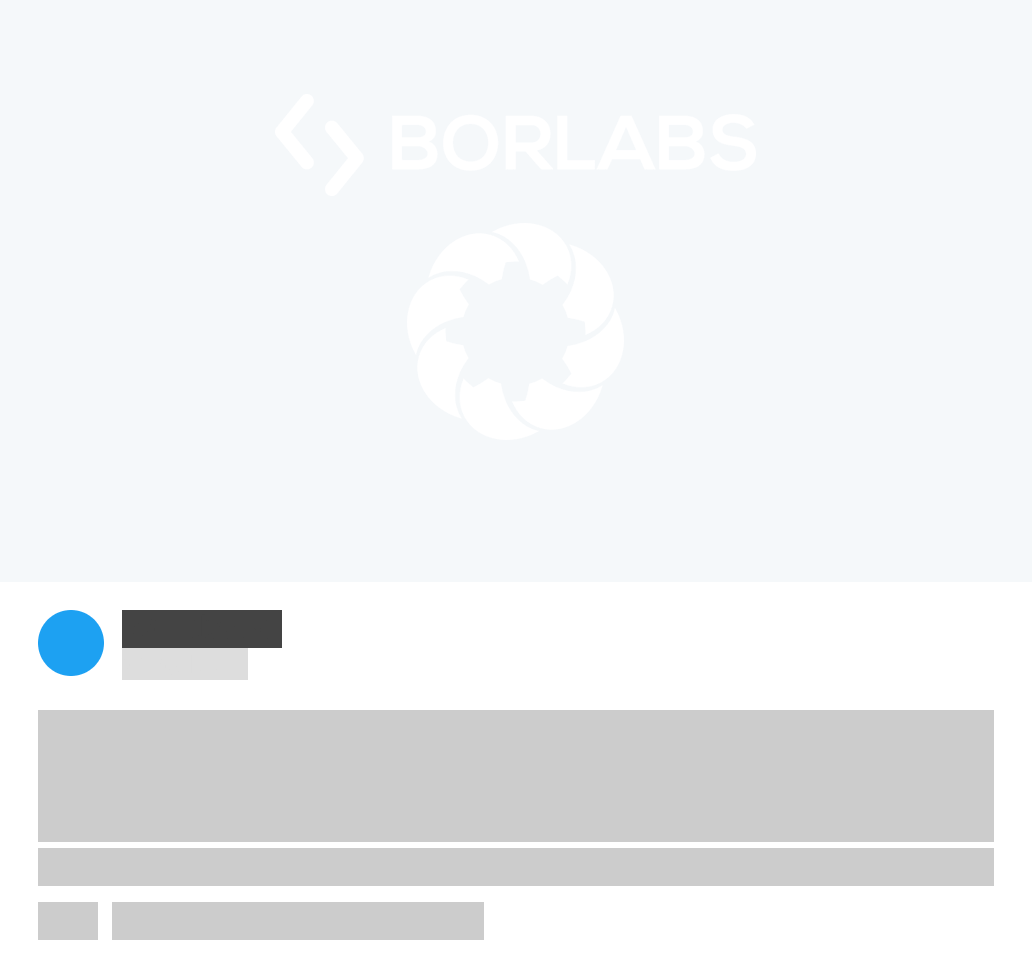
Trackbacks/Pingbacks